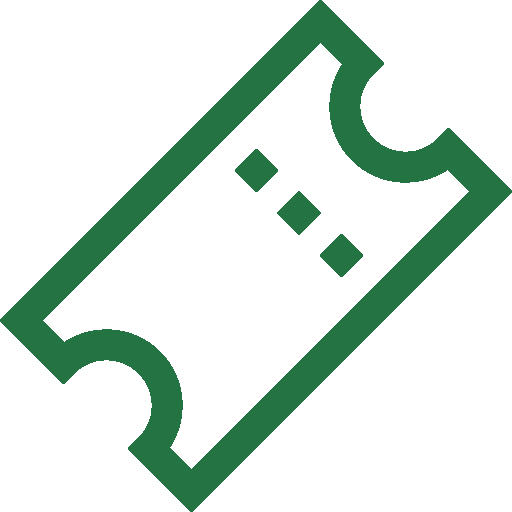Jüdischer Kulturbund
16. Juli 2023 | 16:00 Uhr | Aaron-Bernstein-Platz Berlin | Freiluftkonzert
Christoph Willibald Gluck
Ouvertüre ‚Iphigenie in Aulis‘
Ernest Bloch
Concerto grosso
Emmerich Kálmán
Ouvertüre ‘Die Czárdásfürstin’
Erich Wolfgang Korngold
aus der Orchestersuite ‘Viel Lärm um nichts’
Karl Goldmark
Sinfonie
Werner Seelig Bass
Kleine Musik für Sreicher
Willy Rosen
Lieder arrangiert von Tim Jäkel
Gustav Mahler
Blumine
Felix Mendelssohn Bartholdy
aus der Schauspielmusik ‘Der Sommernachtstraum’
Es werden Texte gelesen u.a. von Ken Baumann, Else Lasker-Schüler, Nelly Sachs, Gertrud Kolmar und Erinnerungen von Künstler*innen des Jüdischen Kulturbundes
Sprecher: Christian Redl und Michael Schrodt
Dirigent: Justus Thorau
Es spielen die Berliner Symphoniker
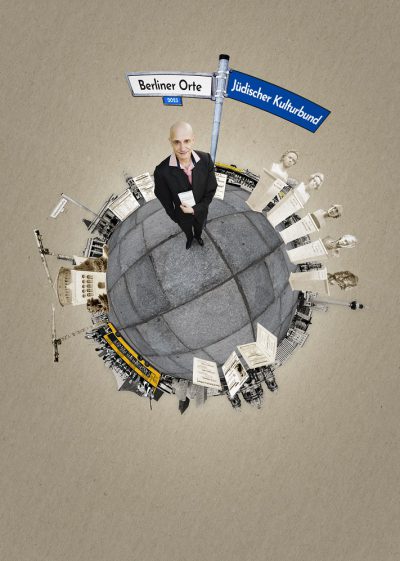
Sonntag, 16.07.2023 | 16 Uhr | Aaron-Bernstein-Platz | AmTacheles Berlin | Open Air
Der Kulturbund wurde im Juli 1933 in Berlin als Reaktion auf die zuvor erfolgten Entlassungen jüdischer Künstler*innen aus den staatlichen Kulturbetrieben gegründet. Initiatoren des Bundes waren der Regisseur Kurt Baumann und der ehemalige Intendant der Charlottenburger Oper Kurt Singer.
Auf dem Programm des Kulturbundes standen Vorträge, Lesungen, Konzerte, Opern-, Operetten- und Theatervorstellungen. In Konzertveranstaltungen wurden neben den ‚Klassikern‘ (Kompositionen u.a. von Beethoven und Mozart) zunehmend Werke von in Deutschland aufgrund ihrer Abstammung verbotenen Komponist*innen gespielt. Das Angebot stand unter strenger Aufsicht des Regimes und war nur für Jüdinnen und Juden vorgesehen.
Auf dem Programm des letzten Konzertes stand u.a. Mendelssohn Bartholdys ‘Sommernachtstraum’.
Am 11. September 1941 ordnete die Gestapo die Auflösung des Jüdischen Kulturbunds in Deutschland an.
In unmittelbarer Nähe des heutigen Aaron-Bernstein Platzes stand die Synagoge der Jüdischen Reformgemeinde (Johannisstraße 16). Die Synagoge war von 1934 bis 1937 Spielort des Jüdischen Kulturbundes. Der Namensgeber des Platzes – Aaron Bernstein – war Mitbegründer des Reformjudentums in Berlin und wirkte als Prediger und Tora-Lehrer, er wohnte in der Johannisstraße 17.
Die Fundamente der Synagoge wurden beim Tiefbau des Areals AM TACHELES wiederentdeckt.
Die Gründung des Kulturbundes jährt sich 2023 zum 90. Mal. Die Berliner Symphoniker erinnern daran und werden Musik und Literatur aus dem Programm des Jüdischen Kulturbunds zur Wiederaufführung bringen und somit diesen Teil der Berliner Geschichte beleuchten.
Künstlerische Leitung: Katja Lebelt in Zusammenarbeit mit dem teatreBLAU
Konzeption: Philippe Perotto